„Ich möchte das Rätsel lösen“
Die Welt verstehen und staunen
Als Postdoc am Walther-Meißner-Institut ist Christian Schneider dafür verantwortlich, die Arbeiten zum Fluxonium-Qubit voranzutreiben. Etwas schaffen, was noch nie zuvor existiert hat – das findet der Physiker besonders faszinierend an seinem Beruf. Dabei widmet er sich nicht nur leidenschaftlich der Entwicklung supraleitender Qubits, sondern sieht in vielen Bereichen spannende Rätsel, die noch gelöst werden wollen.
Von Maria Poxleitner
„Meine Eltern haben ziemlich viel geflucht, weil ich als Kind fast alles zerlegt habe“, erinnert sich Christian Schneider. Wecker, Telefon, Computer. Nicht immer habe er danach alles wieder zusammengebaut, ergänzt der 34-jährige Physiker schmunzelnd. Er sei schon immer sehr neugierig gewesen, wollte schon immer alles ins Letzte durchdringen und verstehen. Nach dem Abi habe er aber nicht so wirklich gewusst, was er machen wolle, meint er nachdenklich. „Zu Computern hat es mich schon immer hingezogen“. Als er sieben Jahre alt war brachte der Vater die ersten Geräte mit nach Hause und Christian und sein Bruder spielten damit. Eine Überlegung war es deshalb, Informatik zu studieren. Sein guter Freund Julian hätte ihn dann aber – wofür er ihm immer noch sehr dankbar sei – vom Physikstudium überzeugt: „Da lernst du über die Welt, hat er gesagt.“
Heute, als Postdoc am Walther-Meißner-Institut (WMI), ist er dafür verantwortlich, die Arbeiten zum Fluxonium-Qubit am WMI voranzubringen und alle Einzelprojekte zusammenzuführen, um letztlich einen Fluxonium-Prozessor zu entwickeln. Das Fluxonium-Qubit, kurz ‚Fluxonium‘, ist ein bestimmtes Design eines supraleitenden Schaltkreises – oftmals ist auch von Architektur die Rede. Supraleitende Schaltkreise sind eine Möglichkeit, Qubits zu realisieren. Für das konkrete Design gibt es wiederum viele Möglichkeiten. Eigentlich habe man einen sehr kleinen Legokoffer, es brauche nur zwei oder drei Elemente, erklärt Christian. Man könne Kondensatoren, Spulen und Josephson Junctions in den Schaltkreis einbauen. Bei letzterem handelt es sich um ein spezielles, nanometerkleines Bauteil, auf das keine supraleitende Qubit-Architektur verzichten kann. „Diese Elemente kann man jetzt wild kombinieren, man kann sich da komplett austoben. Und die Leute machen das auch und entwerfen Schaltkreise, die komplett verrückt ausschauen“, führt der Postdoc aus und die Faszination darüber, dass dabei überhaupt etwas Sinnvolles herauskommen kann, spiegelt sich in seinem Gesicht wider.
Transmon versus Fluxonium
Diesen „Qubit-Zoo“, wie Christian es nennt, mehr zu erforschen, habe immer zum Ziel, Qubit-Designs zu entdecken, die bessere Eigenschaften aufweisen, also zum Beispiel weniger fehleranfällig oder besser skalierbar sind. „Aber man zahlt immer mit Komplexität“, wendet der Physiker ein. Hierin bestünde auch die Erfolgsgeschichte des Transmon-Qubits, der Schaltkreis-Architektur, die zurzeit wohl am etabliertesten ist und auf die auch Firmen wie Google oder IBM setzen. Das Schöne am Transmon, wie Christian findet: „Es ist auf das Essenzielle runtergebrochen und funktioniert. Man nimmt alles raus, was stören kann und macht das System so simpel wie möglich.“ Aber jetzt komme man nach 20 Jahren Forschung und Feinschliff auch an Limits. Die grundlegende Architektur erschwert es, bestimmte Eigenschaften weiter zu verbessern. Und das wiederum motiviert die Forschung zu anderen Architekturen, wie zum Beispiel dem Fluxonium.
Der Postdoc betritt das „Fluxonium-Booster-Lab“. Er muss lachen. So hätten die Doktorand:innen das Labor getauft. Der Kryostat ist geöffnet. Christian zieht sich Handschuhe an, nimmt einen kleinen Schraubschlüssel in die Hand und beginnt, die goldenen Muttern auf festen Sitz zu überprüfen. Fluxonium-Qubits seien sehr anspruchsvoll in der Fabrikation, erläutert er: „Man muss eine Kette von 80 bis 100 Josephson-Kontakten reproduzierbar herstellen, das können weltweit nicht viele.“ Aber auch bei ihnen ginge öfter noch was schief, weshalb die neu fabrizierten Chips vor aufwendigeren Messungen erstmal getestet werden: Kryostat öffnen, neuen Chip platzieren, Leitungen anschließen und prüfen, Schrauben und Muttern nachziehen. „Die Arbeit am Kryostaten ist immer ein Gewurschtel und Durchfieseln“, beschreibt es Christian mit knappen Worten. Der Kryostat hier sei eher klein, damit man ihn schneller runterkühlen und die Testchips schneller austauschen könne. Im benachbarten Raum steht ein größerer Kryostat, an dem gerade eine Messung stattfindet. Man hört die Kühlung arbeiten. Ein periodisches, hohes Keuchen. „Auf der Frequenz habe ich schon einen leichten Hörschaden“, scherzt der Physiker und lächelt.
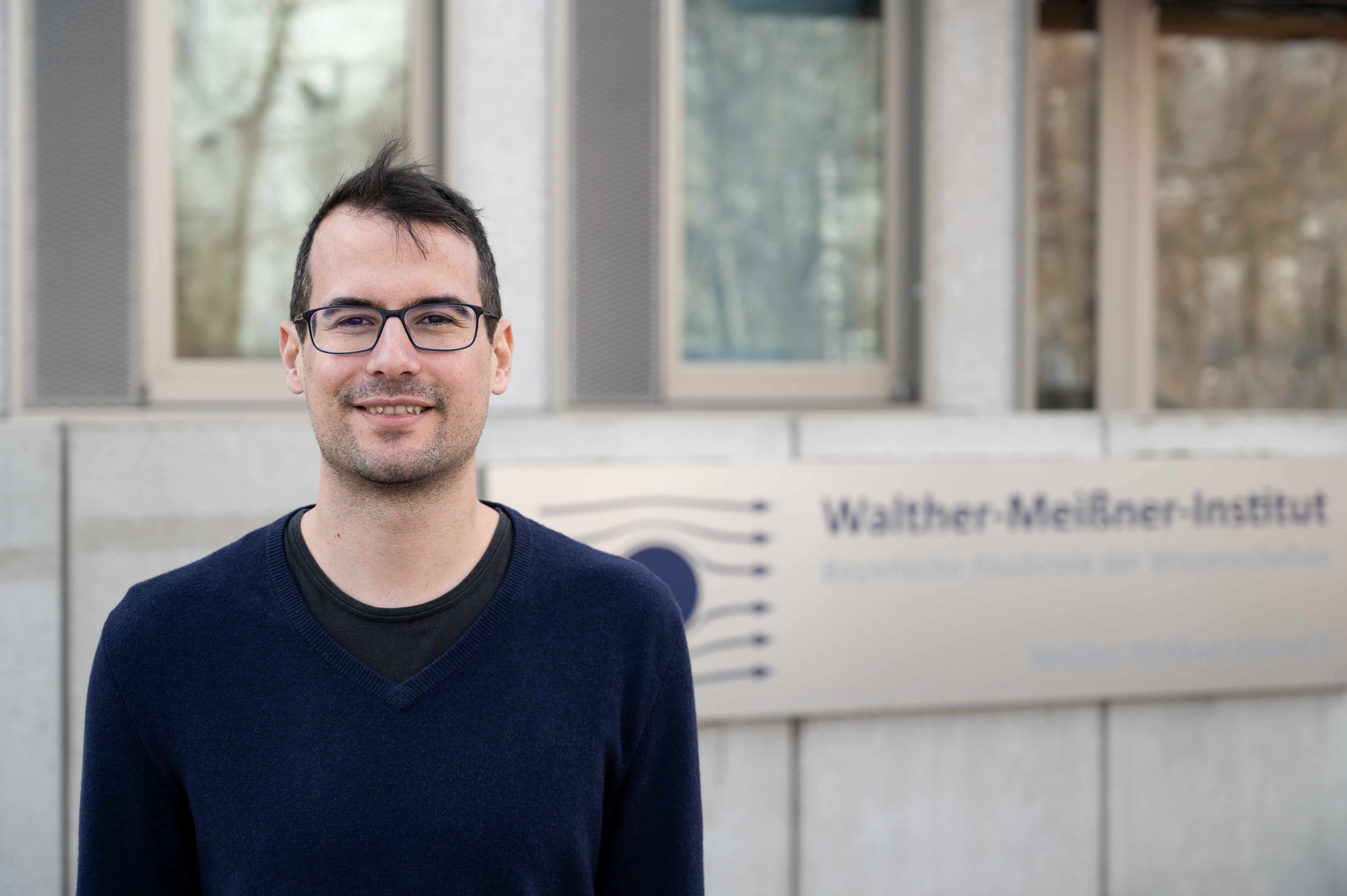
Christian Schneider, 34
Position
Postdoc
Institut
Walther-Meißner-Institut (BAdW)
SQQC
Studium
Physik
Christian forscht zum Fluxonium-Qubit. Dabei handelt es sich um ein bestimmtes Design eines supraleitenden Schaltkreises. Zwar ist die Entwicklung des Fluxonium-Qubits noch nicht so weit fortgeschritten wie die des etablierten Transmon-Qubits, doch ist das Interesse der Forschungscommuity an der alternativen Qubit-Architektur aufgrund ihrer vielversprechenden Eigenschaften groß. Christians Aufgabe ist es, alle Arbeiten zum Fluxonium-Qubit am WMI zusammenzuführen und die Entwicklung eines Fluxonium-Prozessors voranzutreiben.

Den Dingen auf den Grund gehen
Intensive Stunden im Labor oder am Schreibtisch empfinde er oft auch als meditativ, meint Christian. Wenn er vor einem Problem steht, sich aber eine Lösungsidee abzeichnet, dann sei er „komplett drinnen“ und blende alles andere um sich rum aus. Den Dingen auf den Grund gehen und sie wirklich verstehen, das treibt ihn an: „Ich möchte das Rätsel lösen“.
Oberflächlichkeiten scheinen dem Postdoc aber auch in anderen Lebensbereichen fremd. Bis zum Ende des Masters spielte der Gitarrist und Bassist in einer Band, zusammen mit Freunden aus seiner Münchner Schulzeit. Blues und Rock hätten sie vor allem gemacht und immer wieder auf Geburtstagen und Hochzeiten gespielt: „Man spielt dort, wird aber irgendwie auch aufgenommen in die Familie. Man taucht für einen Abend in andere Leben ein, was irgendwie schräg ist, weil man sich danach nie wiedersieht.“ Das sei eine spannende Erfahrung gewesen und er vermisse es ein bisschen, gibt Christian zu und sein Blick wird etwas nachdenklich.
Nach dem Master in München verschlug es den Physiker für den Ph.D. nach Innsbruck. „Innsbruck hat mich damals geflasht. Die Leute dort hatten alle so ein intuitives Verständnis und konnten alles super erklären.“ Christian zog es vor allem wegen Gerhard Kirchmair nach Innsbruck, der als junger Professor von Yale nach Innsbruck gewechselt war, um dort die damals erste Arbeitsgruppe in Österreich hochzuziehen, die an supraleitenden Quantensystemen forschte. „Die Paper aus Yale waren super spannend. Gerhard hat dort echt coole Physik gemacht und ich war fasziniert“, erzählt Christian. In Innsbruck wollte er nun miteinsteigen. Konkret ging es um die Forschung zu makroskopischen Systemen, die in einen quantenmechanischen Zustand gebracht werden, also darum, die „Limits“ der Quantenphysik zu erforschen. „Was passiert, wenn die Quantensysteme wirklich groß werden und was ist zum Beispiel der Einfluss der Schwerkraft auf die Quantenmechanik? Das ist der Übergang, wo unser Know-how aufhört.“ Er selbst habe eine Art kleines „Sprungbrett“ von der Größe eines Haars untersucht, erzählt Christian. Er habe sich mal überlegt, wie dieses System nach einer bestimmten Anregung aussehen würde: „Es ist gleichzeitig nach oben und unten ausgelenkt, schwingt aber nicht.“ Bei dieser Feststellung schwingt ein fast ungläubiges, vor allem aber fasziniertes Lachen in seiner Stimme mit. „Das ist wirklich megakomisch. Sehr, sehr schwer sich das vorzustellen.“ Aber genau das ist es auch, was Christian an seinem Beruf liebt: „Wir stochern am Ende unseres Know-hows herum und versuchen etwas zu schaffen, was noch nie auf der Erde existiert hat.“
„München war der spannendste Fleck auf der Quantenkarte"
Für den Postdoc entschied sich Christian zurück nach München zu kommen und zwar ans WMI, an dem er bereits seine Masterarbeit geschrieben hatte. Seit er aus München weggegangen war, hatte sich dort aber einiges getan, wie er empfindet: „Das, was ich an Innsbruck so geschätzt habe, hat sich nun auch in München gebildet.“ Durch Vorhaben wie das Munich Quantum Valley kämen viele spannende Menschen auf einem Haufen zusammen, die über Physik diskutieren und die Quantentechnologie voranbringen würden. Für ihn war klar, dass er in Europa bleiben will: „Und da war München der spannendste Fleck auf der Quantenkarte.“
Im Rahmen des MQV forscht das WMI parallel am Transmon, dem „Klassiker“, und dem etwas jüngeren Fluxonium. „Was die Qualität unserer Transmon-Qubits betrifft, erzielen wir Rekordwerte“, sagt Christian. Beim Fluxonium hätte man bereits große Fortschritte gemacht, ganz vorne spiele man aber noch nicht mit. Der Postdoc erinnert sich an ein Paper des MIT, des Massachusetts Institute of Technology, das im Jahr zuvor für großes Aufsehen bei ihm und seinen Kolleg:innen gesorgt hatte. Die Forschenden dort hatten ein spezielles Kopplungselement zwischen zwei Fluxonium-Qubits entwickelt, das es ermöglicht, Gatter mit besonders hoher Genauigkeit durchzuführen. „Das war wirklich ein Durchbruch“, betont Christian. Neid oder Enttäuschung, dass es sich dabei nicht um das eigene Paper handelt, scheint der Physiker dabei aber keineswegs zu verspüren. „Ich war nur beeindruckt. Die Fehlerraten. Da kann man nur gratulieren.“
Nicht die eigene Karriere, sondern neue Erkenntnisse, das „mehr verstehen wollen“ treiben den Physiker an. „Eigentlich bedeutet Verstehen für mich, Intuition zu erlangen, ein Gefühl dafür zu bekommen, warum sich etwas so verhält wie es sich verhält“, erklärt Christian. Da komme man bei der Quantenmechanik aber tatsächlich recht häufig an seine Limits. Anders als beim Zerlegen von Wecker oder Telefon, sei man auf Experimente angewiesen, die man nicht mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Händen fühlen könne. Alles bis aufs Letzte durchdringen und verstehen – die Quantensysteme, an denen Christian forscht, machen es ihm nicht immer leicht. „Aber das ist eben auch das Schöne an der Quantenmechanik, dass man immer wieder überrascht wird.“ Die nächsten Jahre möchte er auf jeden Fall in der Forschung bleiben. So kann er auch weiterhin die Grenzen des Verstehens Stück für Stück verschieben und weiter lernen über die Welt.
Veröffentlicht am 26. April 2024; Interview am 13. Februar 2024